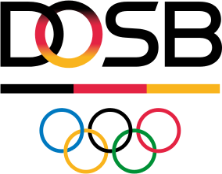- Deutschenfeindlichkeit
-
„Deutschenfeindlichkeit“ ist ein Begriff, den u. a. Rechtspopulist*innen nutzen, um auf sogenannten „umgekehrten Rassismus“ hinzuweisen, wenn also (vermeintliche) Nicht-Deutsche sich gegenüber Deutschen verächtlich äußern, sie angreifen oder Vorurteile haben. Der Begriff impliziert, dass ausschließlich weiße Deutsche gemeint sind, denn sonst könnte von Rassismus gesprochen werden. Dadurch werden etwa Schwarze Deutsche, Jüd*innen, Muslim*innen oder Sinti*zze nicht als Deutsche anerkannt. Indem aber „Deutschenfeindlichkeit“ als „Rassismus gegen weiße Deutsche“ verstanden wird, wird bewusst ausgeblendet, dass weiße Deutsche in Deutschland über die gesellschaftlichen Machtmittel verfügen, erstens „die Anderen“ zu kategorisieren und zu stereotypisieren sowie zweitens die Kategorien und Zuschreibungen institutionell und gesellschaftlich-kulturell zu verankern. Versteht mensch Rassismus in diesem Sinne als Struktur, ist „umgekehrter Rassismus“ in Deutschland nicht möglich, auch wenn einzelne deutsche Menschen sicher Erfahrungen von Ausgrenzung oder Gewalt wegen ihrer (zugeschriebenen) Herkunft gemacht haben können. Der Vorwurf der „Deutschenfeindlichkeit“ zielt häufig – auch unbewusst – darauf ab, Rassismus zu relativieren, „die Anderen“ als Täter*innen und sich selbst als Opfer darzustellen, um auf diese Weise Benachteiligungen und Ausschluss der „Anderen“ als legitime Gegenwehr darstellen zu können.
Siehe auch epistemische Gewalt und gesellschaftlich-kultureller Rassismus
- Dichotomisierung
-
Dichotomisierung bezeichnet in der Rassismuskritik die Zweiteilung einer Gruppe nach bestimmten Merkmalen. Kulturelle, biologische, … Differenzierungen werden mit Begriffsgruppen wie wir/ihr, unsere/eure markiert. Das wir/unsere wird mit positiven, das ihr/euch mit negativen, abweichenden Merkmalen verknüpft. Die negative Darstellung der jeweils anderen führt zu Ausgrenzungsprozessen.
Siehe auch Rassifizierung und Stereotypisierung
- Differenzlinie
-
Angelehnt an die Theorie der Intersektionalität wird davon ausgegangen, dass Diskriminierungsformen Differenzen erst schaffen. Diese beziehen sich jeweils auf eine bestimmtes Merkmale, das zur Kategorisierung herangezogen wird: Die Hautfarbe wird differenziert in schwarz/weiß, das Geschlecht in Frau/Mann, sexuelle Orientierung in heterosexuell/lesbisch, schwul, bi, asexuell usw. Differenzlinien nehmen also dualistische Unterscheidungen vor, die sich ergänzend und hierarchisch aufgebaut sind. D. h. eine Seite der Unterscheidung verhält sich immer als Norm (weiß, männlich, heterosexuell usw.), während die andere Seite als „abweichend“ problematisiert und in Form von Diskriminierungen sozial sanktioniert wird. Da Menschen nicht nur eine, sondern mehrere solcher Differenzkategorien in sich vereinigen, verhilft der Begriff der Differenzlinie dazu, diese komplexen, nicht-binären Gruppenzuschreibungen und Dominanzverläufe zu beschreiben und kritisierbar zu machen. Daraus entsteht eine Kritik des dualistischen und normierenden Unterscheidens. Diesem zufolge sind Differenzlinien als offene Räume zu verstehen, in denen Menschen je individuelle Positionen einnehmen (z. B. im Hinblick auf das Geschlecht) und es daher keine Norm gibt, von der jemand abweichen kann. Die Eigenschaften jedes Menschen sind dann „normal“, insofern sich in ihnen je eine mögliche Ausprägung menschlicher Diversität zeigt.
Siehe auch Dichotomisierung, Dominanz und Gender
- Diskriminierung
-
Diskriminierung ist die ungleiche, benachteiligende und ausgrenzende Behandlung von konstruierten Gruppen und diesen zugeordneten Individuen ohne sachlich gerechtfertigten Grund. Diskriminierung kann sich zeigen als Kontaktvermeidung, Benachteiligung beim Zugang zu Gütern und Positionen, als Boykottierung oder als persönliche Herabsetzung. Der Begriff bezeichnet sowohl den Vorgang als auch das Ergebnis, also die Ausgrenzung und strukturelle Benachteiligung der diskriminierten Personen und Gruppen. Die Durchsetzung von Diskriminierung setzt in der Regel soziale, wirtschaftliche, politische oder diskursive Macht voraus. Diskriminierung ist nicht auf individuelles Handeln beschränkt, sondern auch in gesellschaftlichen, politischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Strukturen verankert. Um dies deutlich zu machen, wird zwischen Diskriminierung auf subjektiver, interaktionaler, institutioneller, gesellschaftlich-kultureller und struktureller Ebene unterschieden.
Siehe Ableismus, Adultismus, Altendiskriminierung, Altersdiskriminierung, antimuslimischer Rassismus, Antisemitismus, Bodyismus, Diskriminierung Ost/West, Gadje-Rassismus, Heterosexismus, Klassismus und Sexismus
- Diskriminierungskritik
-
Der Begriff Diskriminierungskritik wird analog zum Begriff Rassismuskritik verwendet. Er berücksichtigt, dass alle Menschen durch eine Vielzahl von Diskriminierungsformen sozial positioniert werden.
Siehe auch Differenzlinie und Intersektionalität
- Diversität
-
Jeder Mensch hat Eigenschaften, Gewohnheiten und Verhaltensweisen, die ihn von anderen unterscheiden. Einige Merkmale bringen Privilegien mit sich, andere erschweren den Zugang zu Ressourcen. Der Diversitätsansatz problematisiert gesellschaftliche Machtverhältnisse in ihrer Intersektionalität, die über Normen, Diskriminierung und Privilegierungen in Verbindung mit zugeschriebenen Kategorien wie „Hautfarbe“, Herkunft, Aufenthaltsstatus, Religion, Gender, sexuelle Orientierung, Behinderung, Alter und sozialer Herkunft bzw. sozialem Status verknüpft sind. Normen und Macht spielen eine entscheidende Rolle, wenn Menschen von gesellschaftlichen Ressourcen ausgeschlossen werden oder einen privilegierten Zugang zu ihnen erhalten. Diversität bedeutet also nicht nur Vielfalt oder Vielseitigkeit, sondern auch Diskriminierungskritik, Macht- und Normenkritik, Empowerment und Powersharing sowie eine intersektionale Perspektive.
Siehe auch Differenzlinie und diversitätsbewusste Bildungsarbeit
- Diversity Management
-
Das in den USA für das Management von Unternehmen entwickelte Konzept zielt auf die bewusste Nutzung und Förderung der Vielfalt von Mitarbeiter*innen. Dabei geht es nicht nur um Toleranz gegenüber individueller Verschiedenheit (engl.: diversity), sondern um die positive Wertschätzung von Vielfalt. Ziele von Diversity Management sind eine produktive Gesamtatmosphäre, die Unterbindung der Diskriminierung von Minderheiten und die Gewährleistung gleicher Chancen für alle – unabhängig von Alter, Geschlecht, Nationalität, Hautfarbe, Religion oder sexueller Orientierung. Da das Konzept auf den Unternehmensnutzen ausgerichtet ist, wird es aus diskriminierungskritischer Perspektive kritisiert und ist mit dieser Ausrichtung nicht in pädagogische Kontexte übertragbar.
Siehe auch Diversität
- Dominanz
-
Als dominant werden Verhaltensweisen bezeichnet, bei denen andere zur Unterordnung gezwungen werden. Eine Person oder Gruppe setzt sich gegenüber einer anderen Person oder Gruppe durch. Dies geschieht jedoch nicht – wie im Falle von Herrschaft – durch unmittelbaren Zwang in Form von Repression, Ge- oder Verboten. Wenn Machtverhältnisse in die verinnerlichten Normen und sozialen Strukturen einer Gesellschaft eingelagert sind, können vielmehr alle ihre Angehörigen Dominanz ausüben, indem sie die herrschende Normalität bewusst oder unbewusst mittragen. Beispiele dafür sind, wenn rassistische Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt und daraus folgende Segregation mit „kultureller Fremdheit“ oder mangelnder Leistungsbereitschaft erklärt werden; wenn die Gleichberechtigung von Männern* und Frauen* behauptet wird, obwohl Frauen* immer noch den größten Teil der Reproduktions- und Carearbeit leisten; oder wenn die Mitarbeiter*innen eines Amtes von Besucher*innen ganz selbstverständlich verlangen, Deutsch zu sprechen, weil Deutsch Amtssprache sei, ohne Rücksicht auf die Bedürfnisse des Gegenübers. Diese Prozesse festigen wiederum die ungleiche Verteilung von Ressourcen, Repräsentanz und Partizipationschancen, auf der die Ausübung von Dominanz beruht.
Siehe auch Dominanzgesellschaft und Macht
- Dominanzgesellschaft
-
Der Begriff der Dominanzgesellschaft oder -kultur geht auf die Psychologin und Sozialarbeiterin Birgit Rommelspacher zurück. Er versucht das Zusammenleben unter mehrdimensionalen, vielschichtigen Macht- und Herrschaftsbedingungen zu beschreiben. Die Dominanzgesellschaft ist geprägt von einer Geschichte, die Herrschen und Beherrscht werden zu ihren zentralen Ordnungskategorien hat werden lassen. Im Gegensatz zu kolonialen oder faschistischen Gesellschaften ist die Unterteilung in Unterdrückte und Unterdrückende aber nicht eindeutig, sondern verläuft anhand vieler verschiedener Differenzlinien (Frau/Mann, weiß/Schwarz, deutsch/nicht-deutsch, arm/reich usw.), was zu einem Verblassen der kollektiven Identitäten und zu Verunsicherung führt. Zudem sind Über- und Unterordnung in Normen, Normalitätsvorstellungen und Alltagshandeln eingelassen. Diese Uneindeutigkeiten verdecken und rechtfertigen bestehende Ungleichheiten und Diskriminierungen, sodass die Dominanzgesellschaft sich ihrer eigenen Hierarchien nicht bewusst ist (oder sein will), sondern sich (allerdings nur oberflächlich) zu Gleichheit und Gleichwertigkeit bekennt.
Siehe auch Dominanz, Identität, Intersektionalität und Macht
- Doppeltes Bewusstsein
-
Den Begriff „doppeltes Bewusstsein“ (engl. double consciousness) hat der US-amerikanische Soziologe und Schriftsteller W.E.B. Du Bois in seinem 1903 erschienenen Buch „Die Seelen der Schwarzen“ (engl. The Souls of Black Folk) über die Rassentrennung in den USA geprägt. Du Bois beschreibt mit dem Begriff das Gefühl, „sich selbst immer nur durch die Augen anderer wahrzunehmen, der eigenen Seele den Maßstab einer Welt anzulegen, die nur Spott oder Mitleid für einen übrig hat.”* Doppeltes Bewusstsein bezeichnet also eine Form, in der rassistisch diskreditierbare Menschen die Verweigerung von Zugehörigkeit, rassistische Zuschreibungen und Weißsein als Norm verinnerlicht haben. Das eigene Selbst ist dann nur durch den Spiegel von Stereotypen und weißer Normen zugänglich. Die Folgen von doppeltem Bewusstsein können Passivität, Aggressivität, Minderwertigkeitsgefühle und Überkompensation sein. Letzteres bedeutet, dass eine rassistisch diskreditierbare Person einerseits versucht, möglichst angepasst und unauffällig zu sein, um keine Stereotype zu erfüllen und auf diese Weise Diskriminierungen zu entgehen, und sich andererseits offensiv von anderen rassistisch diskreditierbaren Personen abgrenzt, auf die Stereotype zutreffen.
Siehe auch epistemische Gewalt und Rassismus
* Du Bois, W.E.B. (1996 [1903]): The Souls of Black Folk, in: Sundquist, Eric J. (Hg.), The Oxford W. E. B. Du Bois reader, New York, NY: Oxford University Press, S. 97-240, hier S. 102.