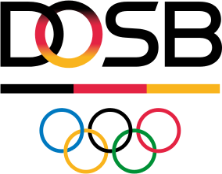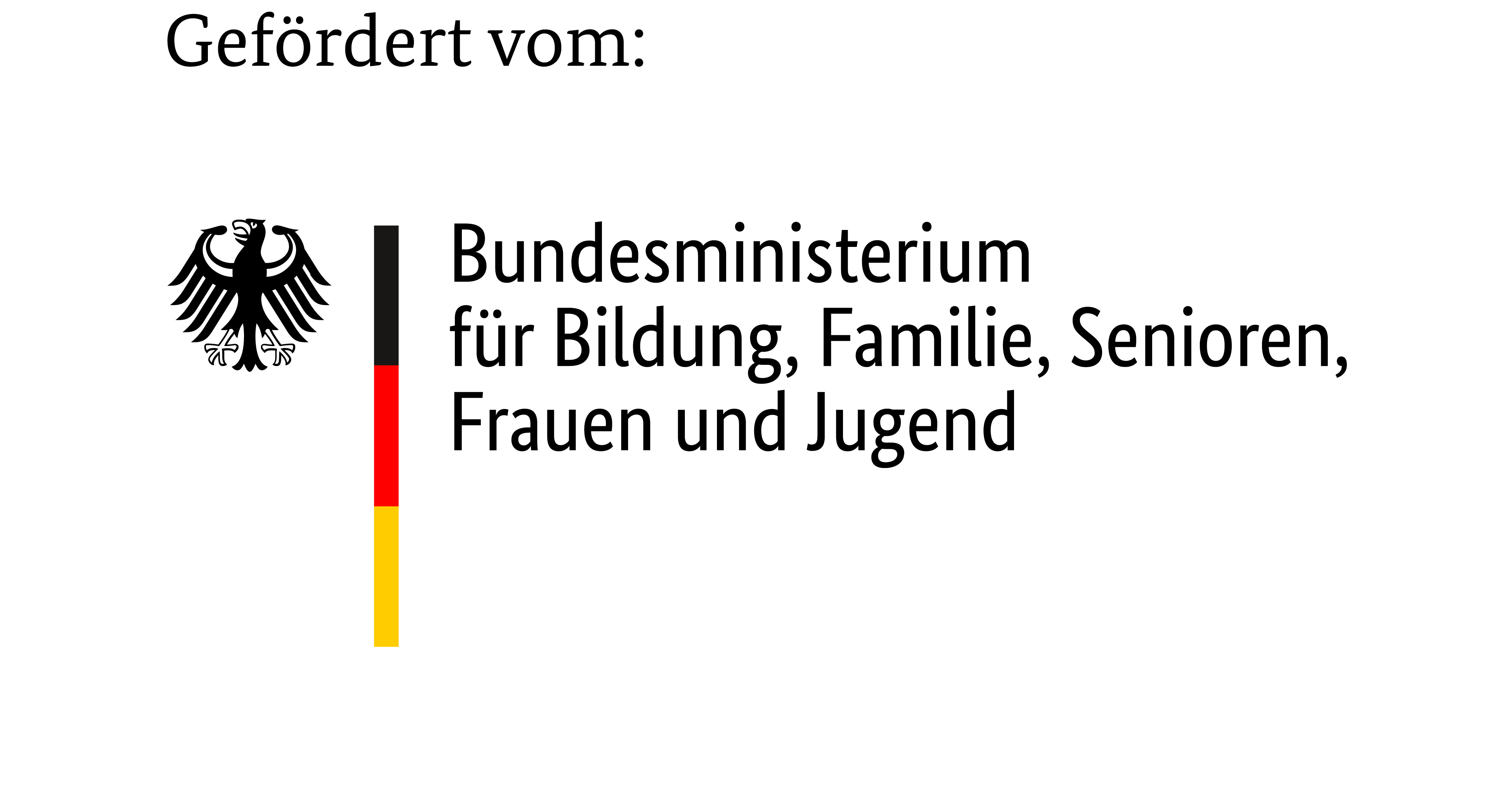Dem Kampfsport wird häufig zugeschrieben, sich nicht eindeutig genug gegen die extreme Rechte zu positionieren, wenn nicht sogar für extrem rechte Einflüsse offen zu sein. Doch ist diese, häufig sehr schnell getroffene, Zuschreibung überhaupt richtig? Ist der Kampfsport tatsächlich so offen „für rechts“, wie behauptet wird? Besitzt Kampfsport nicht auch das Potenzial sich gegen die extreme Rechte zu stellen? Ist er nicht sogar besonders gut geeignet, um Werte und demokratische Einstellungen zu vermitteln? Und kann man in diesem Zusammenhang überhaupt von „dem Kampfsport“ sprechen?
Die dsj ist diesen Fragen im Gespräch mit Robert Claus und Olaf Zajonc, den führenden Experten zu Fragen um Kampfsport, die extreme Rechte und Demokratie in Deutschland, nachgegangen. In den zwei Videointerviews erklären Claus und Zajonc, weshalb extrem rechte Kräfte in der Kampfsportszene präsent sind, wie vielfältig die Kampfsport-Landschaft in Deutschland ist und welche Möglichkeiten dem Kampfsport innewohnen, um sich gegen extrem rechte Einflüsse zu wappnen und stattdessen demokratische Werte zu vermitteln.
Hier geht es zum Video „Warum Nazis gerne Kampfsport machen“
Hier geht es zum Video „Wie der Kampfsport sich gegen extrem rechte Einflussnahme schützen kann“